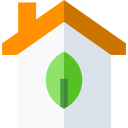Ausrichtung und Gebäudeform
Eine überwiegende Ausrichtung nach Süden maximiert Wintergewinne. Achte auf Verschattungen durch Nachbarbauten, Bäume und Dachüberstände. Plane Blickachsen so, dass Licht tief in die Räume dringt, während sommerliche Überhitzung durch passende Vordächer verhindert wird.
Ausrichtung und Gebäudeform
Ein kompakter Baukörper verringert die wärmeabgebende Fläche. Weniger Oberfläche bedeutet weniger Verluste, sodass solare Gewinne länger wirken. Nutze Rücksprünge und Erker bewusst, um Licht zu lenken, aber vermeide übertriebene Auskragungen, die zusätzliche Transmissionsverluste erzeugen.
Ausrichtung und Gebäudeform
In einem kleinen Öko-Haus am Stadtrand zeigte eine einfache Südverglasung mit massiven Innenwänden, dass an klaren Wintertagen der Wohnraum um mehrere Grad ohne Heizung anstieg. Die Bewohner protokollierten Temperaturen und passten Routinen danach an.